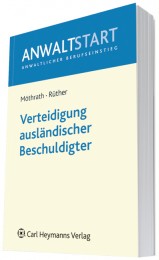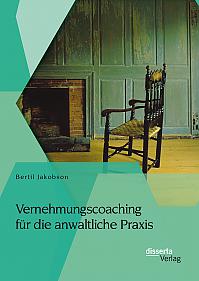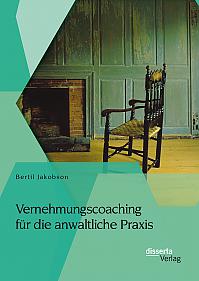 |
Von Bertil Jakobson, Fachanwalt für Straf- und Verkehrsrecht, Moers
828 Seiten – ISBN: 978-3-95425-996-0, EUR 64,90
Wie kann man Menschen beeinflussen und manipulieren? Woran erkennt man Hinweise für eine Lüge? Welche praktische Bedeutung besitzt nonverbale Kommunikation? Wieso treffen Menschen vorhersagbar irrationale Entscheidungen? Die menschliche Kommunikation ist ein hochkomplexer Vorgang, der nicht nur aus dem gesprochenen Wort alleine besteht. Lautlose Signale wie Körperhaltung, Gestik, Mimik, Emotionen und Gefühle beeinflussen ein Gespräch nachhaltiger, als das gesprochene Wort es alleine vermag. Menschen treffen vorhersagbar irrationale Entscheidungen, erliegen kognitiven Täuschungen und sind für Manipulationen wie Suggestionen empfänglich. Mit dem vorliegenden Buch erläutert ein Rechtsanwalt anhand real geschehener und fiktiver Sachverhalte die mannigfachen Möglichkeiten, mittels Fragen und anderer Gesprächstechniken steuernden Einfluss auf die zwischenmenschliche Kommunikation auszuüben. Zu den Inhalten des Buches gehören u.a.:
- Aktive und passive Gesprächstechniken
- Vernehmungstaktische Fragetechniken
- Die Bedeutung und Auswirkung nonverbaler Kommunikation
- Der Einfluss von Emotionen und Gefühlen auf Kommunikation
- Kognitive Täuschungen
- Aussagepsychologische Grundlagen
- Manipulationstechniken
- Gedächtnisfehlleistungen
- Gerichtliche Beweiswürdigung und Tatsachenfeststellung
- Sprachproduktion und Psycholinguistik u.v.m.
Textprobe:
Kapitel 1.3, Fragetechniken: Taktische Vorüberlegungen: Es empfiehlt sich bei fast allen Vernehmungen, vor deren Beginn sich ausreichend Gedanken darüber zu machen, welchen Erkenntnisgewinn man sich von der anstehenden Vernehmung verspricht oder erhofft.
M.a.W.: Sie sollten unbedingt im Vorfeld abklären, welches Ziel Ihre Vernehmung(en) haben soll(en). Denn erst wenn dieses Ziel klar definiert worden ist (z.B. den Zeugen unglaubwürdig aussehen lassen, diesen für die eigene Partei prozessual eher günstigen Aussagen tätigen zu lassen, im Geschäftsgespräch die Oberhand zu gewinnen etc.), ist eine spätere Prüfung während der Vernehmung möglich, ob dieses Vernehmungsziel erreicht wurde. Wenn Fragen z.B. aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung kreiert und dort mehr oder weniger aus dem Handgelenk geschüttelt werden, besteht die Gefahr, dass das Vernehmungsziel aus dem Fokus gerät. Schlimmstenfalls werden sogar Fragen gestellt, die kontraproduktiv sind. Das kann zur Folge haben, dass während der Befragung unbemerkt bleibt, dass man sich bildlich gesprochen auf dem Holzweg befindet.
Andererseits kann auch die Situation eintreten, dass man eine Vernehmung frühzeitig beenden kann, weil z.B. ein Zeuge (entgegen der eigenen Prognose) keine belastenden Angaben gemacht oder das Beweisziel glaubhaft bestätigt hat. Oder es könnte je nach Lage der Dinge gefährlich sein, einem Zeugen weitere Fragen zu stellen, weil dieser aus dem Lager der eigenen Partei sich rauszureden droht. So betrachtet wird es immer wieder Situationen geben, bei denen es (prozess-) taktisch klug ist, von weiteren Fragen abzusehen, bevor die Auskunftsperson für die eigene Partei oder den Mandanten im Geschäftsgespräch mit Konkurrenten eher ungünstige, kompromittierende oder sonst unangemessene Angaben macht.
Nochmals: Es gibt keine a priori richtigen und/oder falschen Fragen, aber es kann einen falschen Zeitpunkt geben, Fragen zu stellen. Es ist ratsam, vor Stellung einer Frage kurz innezuhalten und nachzudenken, ob es in der betreffenden Vernehmungssituation wirklich erforderlich ist, diese Frage und/oder weitere/andere Fragen zu stellen. Bedenken Sie dabei bitte, dass niemand von uns das Rad der Zeit zurückdrehen kann: Hat z.B. ein Zeuge auf eine retrospektiv betrachtet überflüssige oder gar ungeschickte Frage erst einmal geantwortet, ist diese Antwort in den Köpfen aller Gesprächsteilnehmer vorhanden und kann den Ausgang der Vernehmung wenigstens mittelbar beeinflussen.
Mit jeder weiteren Frage besteht ein Risiko, dass die Vernehmung in falsches Fahrwasser gerät. Vernehmungsbereitschaft schaffen: Eine erfolgreiche Vernehmung hat gelegentlich zur Voraussetzung, dass Ihr Gesprächspartner auch mit Ihnen reden will. Das kann z.B. dann nicht unbedingt zu erwarten sein, wenn Sie als Verteidiger den Ermittlungsführer der Polizei in einem Strafprozess gegen Ihren Mandanten vernehmen. Auch bei der Stellung von Fragen gilt, dass Menschen hauptsächlich darauf reagieren, wie etwas kommuniziert, bezeichnet, ausgesprochen etc. wird.
Es gibt neben Fragen mannigfache andere Gesprächstechniken, auf die man aktiv und passiv zurückgreifen kann. Jede Vernehmung vor Gericht hat eine erste Frage. Es gibt keine zweite Chance, eine erste Frage zu stellen. Der Anfang der Vernehmung kann für den weiteren Verlauf derselben grundlegende Bedeutung erlangen. Es ist zu diesem frühen Zeitpunkt darauf zu achten, dass es gelingt, die Gesprächsbereitschaft des Gegenübers zu erreichen. Es ist der Gesprächsbeginn, der maßgeblich darüber mitbestimmt, wie sich der weitere Verlauf des Gesprächs gestalten wird. Wenn es den Gesprächsbeteiligten nicht gelingt, in dieser frühen Phase eine – bildlich gesprochen – kommunikative Brücke zwischen sich zu errichten, wird der Rest des Gespräches voraussichtlich nicht optimal verlaufen und schlimmstenfalls dazu führen, dass das intendierte Vernehmungsziel nicht erreicht wird.
Je nach Einzelfall kann es so betrachtet einen vernehmungstaktischen Fehler darstellen, eine Auskunftsperson, von der man nicht weiß, in wessen Lager sie steht und welche Angaben sie machen wird, bereits am Anfang einer Vernehmung mit mutmaßlich kompromittierenden oder sonst unangenehmen Fragen zu drangsalieren. Aus diesem Grunde empfehle ich ausnahmslos, der Auskunftsperson jedenfalls zu Beginn der Vernehmung freundlich und möglichst offen gegenüberzutreten. Sollte sich diese, aus welchen Gründen auch immer, Ihnen gegenüber im weiteren Vernehmungsverlauf ungebührlich verhalten, könnten Sie immer noch den eigenen Umgang mit dieser Person modifizieren. Andererseits kann es ein taktisches Kalkül darstellen, dass Sie z.B. einen Zeugen sofort forsch angehen, damit dieser dichtmacht oder sich beleidigt zurückzieht. Die Entscheidung für den geeigneten Umgang mit der jeweiligen Auskunftsperson ist stark von der jeweiligen Vernehmungssituation abhängig.
Hier können Sie die auf den folgenden Seiten ausgeführte Taktik anwenden: Die Begrüßungsfrage: Weil Menschen häufig darauf reagieren, wie etwas gesagt wird, sollte diese wichtige kommunikationspsychologische Erkenntnis unbedingt bei der allerersten Frage berücksichtigt werden. Daraus folgt für die hier interessierenden Fragetechniken, dass aus der Art und Weise, wie Fragen gestellt werden, in der betreffenden Auskunftsperson positive oder negative Stimmungen Ihnen gegenüber hervorgerufen werden können. Meist ist es hilfreich, vor Stellung der ersten Frage die Auskunftsperson so anzusprechen, dass diese sich wohl oder sogar geschmeichelt fühlt.
Die erste Frage kann daher quasi eine Art Begrüßungsfrage sein. Eine solche stellt streng genommen keine Frage dar. Es ist ein kommunikationstaktisches Vehikel, um die Auskunftsbereitschaft der Auskunftsperson zu erreichen. Hier gilt zu bedenken, dass wir etwas von unseren Gesprächspartner wollen, namentlich die Kundgabe bestimmter Informationen. Diese ungemein wichtige erste Anrede kann z.B. wie folgt vorgenommen werden: Beispiel: Verteidiger an Belastungszeugen: Sie haben dem Gericht schon zahlreiche interessante Dinge über den Vorfall berichtet. Ich habe den Eindruck, dass Sie bereits lange im Verkehrskommissariat arbeiten und daher über viel Erfahrung verfügen.
Ich habe noch einige Fragen, bei denen Sie mir sicherlich weiterhelfen können. (positive Ansprache). Eine negative Erstansprache hingegen könnte wie folgt vorgenommen werden, um einen Zeugen frühzeitig anzufahren und mundtot zu machen: Beispiel: Herr Mustermann, Sie sind Polizeibeamter. Sie haben bereits gesagt, dass Sie nur die Anzeige geschrieben haben. Das ist mir egal. Ich werde Sie dennoch zum Vorfall befragen. (negative Ansprache). Bei Zeugenvernehmungen vor Gericht kann es sowohl einen Vorteil, als auch einen Nachteil darstellen, als letztes den Zeugen befragen zu dürfen.
Zu den prozessrechtlichen Rahmenbedingungen einer Zeugenvernehmung erfolgen an anderer Stelle weitere Ausführungen. Hier ist auf folgendes hinzuweisen: Durch die Vernehmungen anderer Verfahrensbeteiligter hat man sich einen guten Eindruck vom Aussageverhalten des Zeugen verschaffen können. Diese Erkenntnisse lassen sich durchaus bei der eigenen Vernehmung des Zeugen berücksichtigen. Vielleicht wurden schon zahlreiche Fragen, die man selbst vorformuliert hatte, durch andere Verfahrensbeteiligte gestellt. Das könnte sogar zur Folge haben, dass die eigenen Fragekataloge in sich zusammengeschmolzen sind. Insbesondere kann sich auch die möglicherweise günstige Situation einstellen, dass der Zeuge einen ermatteten Eindruck macht, weil er bereits stundenlang vernommen worden ist.
Dann kann eine positive erste Ansprache den Zeugen aufbauen, ihm schmeicheln oder sonst Aussagebereitschaft schaffen. Vielleicht wurde er, egal ob zu Recht oder Unrecht, von einem anderen Verfahrensbeteiligten hart angegangen und ist von Ihrem höflichen wie freundlichen Auftreten angetan. Durch die im obigen Beispiel genannte erste Anrede des Zeugen erhält dieser einen positiven ersten Eindruck von seinem neuem Gesprächspartner und wird sich wahrscheinlich eher öffnen, als wenn er negativ angesprochen würde. Perfide könnte es z.B. sein, eine gute Beziehungsebene dadurch zu etablieren, indem man den Zeugen zunächst fragt, ob er eine Zigarettenpause (selbst wenn man weiß, dass er Nichtraucher ist) oder sonst eine Pause benötigt. Warum diese Schmeicheleien und/oder Aufmerksamkeiten? Dem Zeugen wird mit derartigen Angeboten auf einer Metaebene der Kommunikation signalisiert, dass man ihm helfen will oder sonst an ihm interessiert ist – selbst wenn beides überhaupt nicht der Fall ist.
Zum Autor:
Bertil Jakobson (Jahrgang 1976) ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht und Verkehrsrecht.
Neben seiner eigentlichen Arbeit als forensisch tätiger Anwalt beschäftigt er sich seit Jahren mit den Möglichkeiten, Erkenntnisse und Forschungsergebnisse verschiedener Wissenschaften für die tägliche Gesprächspraxis vor und außerhalb von Gerichten nutzbar zu machen. Seit 2010 hält er regelmäßig bundesweit Vorträge über tatsächliche und rechtliche Fragen zwischenmenschlicher Kommunikation für Verbände und Organisationen. Er lebt und arbeitet in Duisburg und Moers am Niederrhein.
Zu beziehen: http://www.diplomica-verlag.de/recht-wirtschaft-steuern_66/vernehmungscoaching-fuumlr-die-anwaltliche-praxis_162916.htm |